
Weder unterwegs noch mit Kindern – welche ihre Besuchs- und Empathiequalitäten in keiner Weise an den Tag legten -, dafür ziemlich immobil und die ersten Tage nach der aufwändigen Fuß-Operation am linken Fuß so mit Schmerzmitteln und Opioiden zugepumpt, dass mein linkes Bein von den Zehen über das Knie bis zum Oberschenkel taub war, lag ich im Dunklen des Krankenhauszimmers. Bei jedem ertönenden Piepsen von Alarmtönen oder auch Patientenrufen, die auch des Nachts aus zahlreichen weiteren Zimmern der Station in regelmäßigen Abständen laut und deutlich zu vernehmen waren, wuchs von Stunde zu Stunde mehr die Erinnerung an die, gerade mit den Zwillingen, verbrachten wochenlangen leid- und qualvollen Aufenthalte im Krankenhaus. Völlig übermüdet, aber gleichzeitig allein schon wegen der erzwungenen Rückenlage, die für mich als eingefleischte Seitenschläferin immer schon völlig inakzeptabel war, konnte ich den Wunsch meines Vaters im Krankenhaus nach Schlafmitteln einmal mehr bestens nachvollziehen, zermürben einen doch gerade in den nächtlichen Stunden viele quälende Grübeleien noch einmal deutlich mehr als bei Helligkeit.

Zudem kam ich mir seit der Operation völlig nutz- und wertlos vor, durfte ich doch zunächst noch nicht einmal für einen Toilettengang das Krankenbett verlassen, so dass ich mit den Tücken der Bettpfanne, welche mir bereits durch meine beidseitigen Hüftoperation als Kind bestens vertraut war, zu kämpfen hatte. Diese an sich schon etwas entwürdigende Situation wurde noch gesteigert, als ich in der besagten Bettpfanne noch überaus sichtbare Feststoffe des vorigen Benutzers entdeckte, sowie durch die Anwesenheit eines – verständlicherweise – alles anders als motivierten Pflegers. In meiner frisch operierten Situation stellte es zudem schon einen Kraftakt dar, das OP-Höschen, das dem Diminutiv allerdings kaum gerecht wird und treffenderweise eher mit dem Augmentativ im Italienischen als „calzone“ bezeichnet werden müsste (worunter man jedoch heutzutage nur eine gefüllte Pizza versteht), so herunterzuziehen, dass keine Schläuche oder Verklebungen der sich im Oberschenkel gelegten Schmerzkatheter herausgerissen wurden.

Der einmalige Pflichtbesuch am nächsten Tag eines Teils der Kernfamilie fiel ausgesprochen kurz aus. „Und, was machst du so den ganzen Tag?“ begrüßte mich unsere Tochter beim Betreten des Krankenzimmers, halb anklagend, halb interessiert und fast neidisch. „Du hast ja echt einen großen Fernseher.“ (den ich in all den Tagen ein einziges Mal für eine knappe Stunde angeschaltet hatte, da ich auf eine interessante und erschreckende Wissenschaftssendung gestoßen war, in der die vielfältigen Gefahren des inflationären Smartphonegrbrauchs erörtert wurden), stellte sie im Anschluss fachmännisch fest, „bekommst du da auch RTL?“ „Keine Ahnung“, antwortete ich wahrheitsgemäß und ermattet, „ich habe solche starken Schmerzen, dass ich mich auf nichts recht konzentrieren kann.“ So viel Empathie wäre allerdings für eine Tochter im Teenageralter zu viel verlangt und man sah ihr stattdessen buchstäblich an, wie sehr sie mich um das Bett und gerade auch den Fernseher, den sie unverzüglich für solch bildende Sendungen wie „Tüll und Tränen“ oder auch „First Dates“ und viele weitere Trashserien, von deren Existenz ich noch nicht einmal etwas weiß, in Dauerschleife genutzt hätte, beneidete. Unser älterer Sohn dagegen war ausgesprochen wortkarg, wollte sich noch nicht einmal seiner Winterjacke entledigen und freute sich einzig, als ich ihm beim Unterzuckeralarm statt der üblichen Gummibärchen etwas von den kleinen Krankenhaussaftfläschchen anbieten konnte.

Und der Vater glänzte trotz physischer Anwesenheit durch absolute geistige und emotionale Abwesenheit, sein Anblick erweckte dafür unverzüglich ein Déjà-vu, wie ich es vor 22 Jahren wenige Tage nach der Geburt unserer ältesten Tochter bereits erlebt hatte. Hatte ich mir damals ausgemalt, wie er während seines Wochenbettbesuchs im Krankenhaus mir das schreiende Bündel kurz abnehmen und in den starken väterlichen Armen beruhigend sanft hin und her wiegen würde, fiel er ermattet von den Anstrengungen der vergangenen Tage in meinem Wöchnerinnenbett in einen tiefen Schlaf, nachdem ich gerade noch mit dem Stillen unserer Tochter beschäftigt war. Da nun zwei Jahrzehnte später, das Bett bereits durch mich besetzt war, musste er mit dem -offenbar überaus bequemen – Komfortsessel, der zwischen meinem Bett und dem Fenster positioniert war, Vorlieb nehmen. Aber auch in dieser Position ließ es sich offenbar bestens schlafen, bis von den Kindern zum Aufbruch getrommelt wurde, da noch der abendliche Zumbakurs besucht werden sollte.

Übrigens kann ich berichten, dass ich die Tage im Krankenhaus auch ohne das Anschalten des Fernsehers gut ausgefüllt verbrachte. Den sehr schlafarmen Nächten folgte stets ein früher Morgenbeginn in der Klinikroutine, dem sich ein Frühstück anschloss, das weniger ein kulinarisches Vergnügen als vielmehr die Grundlage für die Einnahme der ersten der etwa 15 täglichen Tabletten darstellte. Danach quälte ich mich mit dem Stehwagen, bei dessen Benutzung zuverlässig gleich bei der ersten einseitigen Belastung ein großer Schmerz in meine rechte Hüfte stach, in das Bad. Notdürftig wusch ich mich und war dabei erstaunt, wie umständlich sich dies gestaltet, wenn man alles quasi nur im Flamingostand betreiben kann, und welch akrobatischer Leistung es bedarf, mit einem Gehwagen „bewaffnet“ und Schmerzkathetern im Oberschenkel, überhaupt erst einmal einen Unterwäschewechsel zu vollziehen, ohne irgendwelche Kabel herauszuziehen.

Danach wurde ich für meine Mühen mit einer kurzen Lymphdrainage belohnt, die von einer sehr lieben Ukrainerin durchgeführt wurde, der ich jeden Tag die verschiedensten Lerntipps für eine erfolgreiche Beschäftigung ihres Sechstklassohnes mit der französischen Sprache geben konnte, nachdem sie etwas verzweifelt an dem Klassenelternabend im Gymnasium von der Lehrerin erfahren hatte, dass fast die gesamte Klasse offensichtlich viel zu wenig fundierte Kenntnisse im Französischen besäße. Meine Ratschläge erfreuten nicht nur die Therapeutin, sondern lenkten mich wenigstens auch kurzfristig von meinen Schmerzen und dem Hadern mit der Gesamtsituation ab, in der ich mich tatsächlich nicht nur wie eine 80- oder 90-Jährige fühlte, sondern schockierenderweise auch mein Knochenzustand diesem wesentlich höherem Alter entsprach, wie es bei einer sofort veranlassten Knochendichtemessung grauenhafterweise diagnostiziert worden war. Als der Operateur mir am Tag nach der Operation von meinen so weichen Knochen berichtete, dachte ich ursprünglich noch, dass ihm dies doch beim Zersägen selbiger deutlich die Arbeit erleichtert hätte, die Beschaffenheit dieser gab jedoch großen Anlass zur Sorge, da unverzüglich eine Osteoporose – etwas, mit dem sich wohl die wenigsten Mittevierzigjährigen beschäftigen werden – erkannt wurde.

Phasenweise war ich physisch und psychisch so belastet, dass ich mir wünschte, in einen Dornröschenschlaf für die nächsten drei bis sechs Monate zu fallen, um keine Schmerzen, keine Sorgen und keine inneren und äußeren Verletzungen fühlen zu müssen. Die Realität ließ mich jedoch wachbleiben und immerhin ein kleines gutes Werk für die Schwiegermutter verrichten, welche plötzlich erneut von einem schweren Bandscheibenvorfall heimgesucht worden war, bei dem keines der gängigen Schmerzmedikamente half. So teilte ich nicht wie der heilige Martin den Mantel – dafür war es ja eh noch einen Monat zu früh -, sondern die stärksten Schmerzmittel – und dabei auch meine eigenen Schmerzen – , mit der Schwiegermutter und freute mich sehr, als der Schwiegervater, dem ich die Medizin überreicht hatte, am nächsten Tag berichtete, dass dies wirklich die einzigen Tabletten gewesen sein, die geholfen hätten.

Leider nahm der Schlaf in keiner der Krankenhausnächte einen großen Teil der Zeit in Anspruch, gelang es mir doch nicht nur kaum in der erzwungenen Rückenlage und nicht in meiner bevorzugten Seitenlage zu schlafen, sondern verstärkten sich auch abends/nachts zuverlässig meine Knochenschmerzen so stark, dass an Entspannung nicht zu denken war. Und dann gab auch noch der Perfusor, der in regelmäßigen Abständen automatisch über die im Oberschenkel gesetzten Katheter ein Lokalanästhetikum verabreicht, um 3.30 Uhr Alarm, dass kein Betäubungsmittel mehr enthalten sei. Nach einem relativ umständlichen Wechsel hatte die Nachtschwester offenbar den Katheter nicht mehr richtig angestöpselt, so dass alles auf die Bettdecke tropfte statt zum heftig schmerzenden Fuß zu gelangen.

Mehrere Nachjustierversuche scheiterten, der eigentlich dafür zuständige Anästhesieschmerzdienst war nicht erreichbar und einmal mehr fühlte ich mich hilflos dem Krankenhausbetrieb, deren pflegerische Dienste ich von Beginn an kaum beanspruchte, versuchte ich doch immer alles möglichst selbständig zu machen, ausgeliefert. Nach Stunden ohne Schmerztherapieversorgung wurde das Problem sehr pragmatisch gelöst, indem man einfach den Katheter zog und hoffte, dass die orale Schmerzmittelversorgung, welche mit 13 täglichen Tabletten und optional weiteren Oycodontabletten sogar die Anzahl der Speisen, welche traditionell zu Weihnachten in Polen als Erinnerung an die 12 Apostel aufgetragen werden, übersteigt, ausreichen würde.

Bei der morgendlichen Visite am Entlassungstag begutachtete der Operateur meinen Fuß und war mit dem Ergebnis so weit zufrieden. „Wir haben so viele Knochen zersägt, da sind die großen Blutergüsse völlig normal.“ beruhigte er mich. Nachdem ich noch genauestens instruiert wurde, wie lange kein Wasser an meinen Fuß darf – ich leide jetzt schon sehr darunter, in diesem Herbst und Winter in keiner Weise meinem liebgewonnenen Ritual des wöchentlichen Eisbadens nachgehen zu können – ermahnte er mich beim Rausgehen noch einmal eindringlich, was es als allerwichtigstes für die kommenden sechs bis acht Wochen zu beachten gäbe. Verletzt, wie sich einige meiner Familie mir gegenüber auch während meiner Krankenhauszeit verhalten haben und wahrscheinlich auch der Übermüdung geschuldet, verstand ich dabei zunächst etwas ganz anderes, als wie es der Professor tatsächlich gesagt hatte. „Nicht aufregen!“, er hatte jedoch „Auf keinen Fall auftreten!“ gesagt…Immerhin fällt mir das Auftretverbot noch etwas leichter als der Vorsatz der Gelassenheit…

Auch während meines stationären Aufenthalts blieb ich mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern in Kontakt, welche mir nicht nur beste Genesungswünsche übermittelten, sondern auch mein Gedächtnis fit hielten, in dem ich gefragt wurde, ob ich mich noch erinnern würde, von wem ich alles die Skilagerzettel eingesammelt hätte, welchen Fehlerschritt ich stets bei den Vokabeltests anwenden würde und zudem beschäftigte ich mich mit einer Kollegin noch intensiv mit der Frage, ob wir ein ganz neuartiges P-Seminar ins Leben rufen sollten sowie vieles mehr. Selbstverständlich konnte ich dies, mit großen Schmerzen und äußerst immobil, nur alles auf digitalem Wege verrichten.

Höchst analog und ereignisreich verlief es für mich jedoch gleich am Mittag des Entlassungstages, an dem ich nicht nur trotz großer Einschränkungen, mich an den Abtrag des großen Wäscheberges machte, sondern auch einige andere nicht ganz alltägliche Aufgaben im frisch operierten Zustand zu bewältigen hatte, wovon in der nächsten Kolumne Näheres zu lesen sein wird…


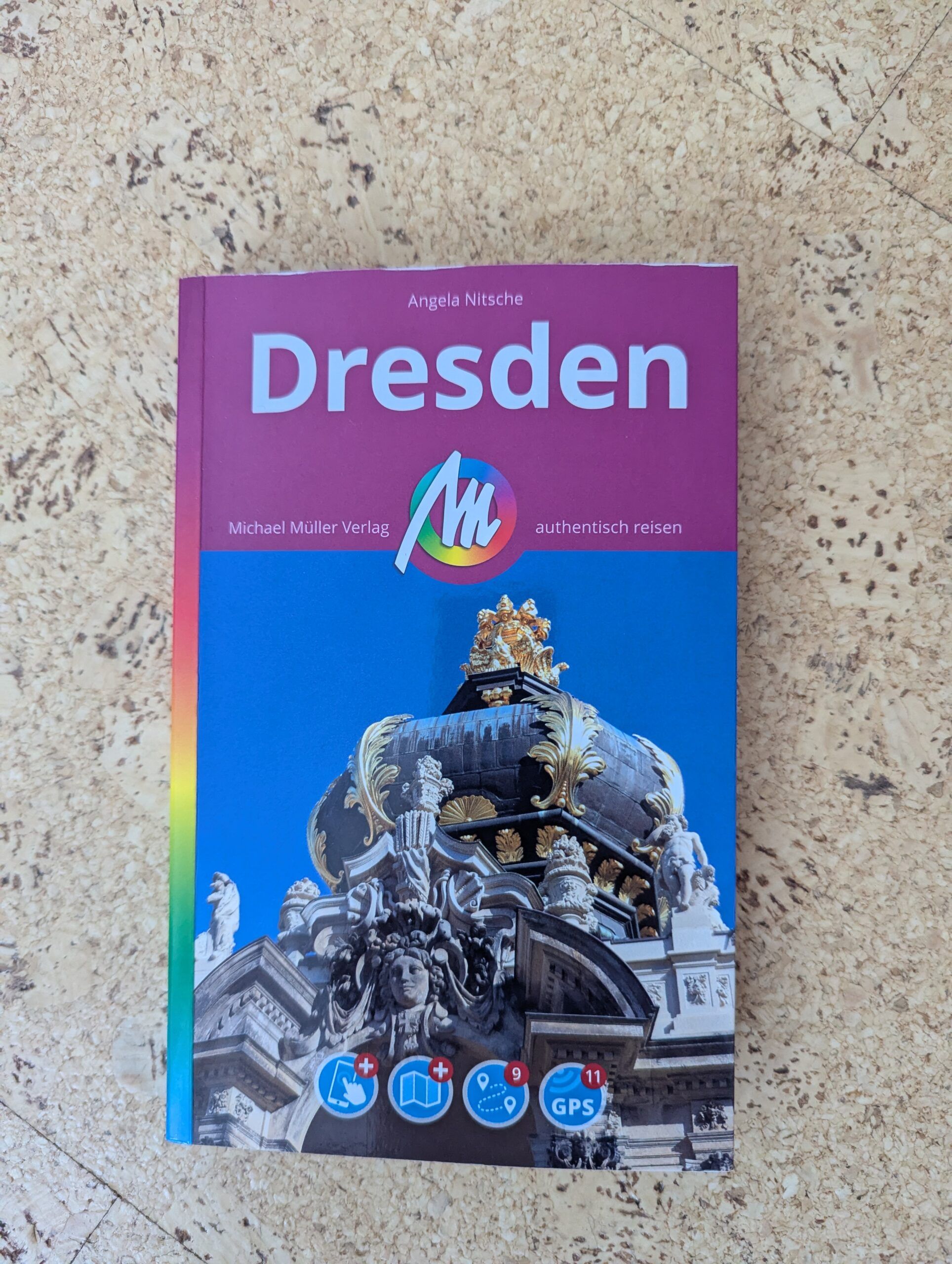

Schreibe einen Kommentar