
Bestanden zu Beginn unserer Abfahrt mit dem SUP einzig meine Sorge bezüglich eines Sonnenbrands an meinen Füßen und Beinen – hatte ich diese Stellen doch brav als fürsorgliche Mama bei den Jungs mit Sonnencrème versorgt, bei mir aber vor lauter Stress vergessen – sowie die Befürchtung, dass mit unserem Jüngeren in der Zeit unserer Abwesenheit irgendetwas passieren könnte, da dieser uns partout nicht auf der SUP-tour begleiten wollte, mutierten die Sorgen auf dem Wasser rasch zu existenziellen Ängsten.

Wir waren bei großer Hitze und Sonnenschein sowie besten Blutzuckerwerten gestartet. Da die Jungs im Wasser ja keine Insulinpumpen tragen, bin ich die ganze Zeit dauerangespannt, dass die Werte nicht nach oben oder unten völlig entgleisen, ist doch z.B. das Paddeln oft so anstrengend, dass die Blutzuckerwerte beunruhigend schnell zu tief nach unten klettern können.

Unser Älterer ist ein echter SUP-profi. Wann immer er mit dem Paddeln an der Reihe war, pflügten wir doppelt, ja dreifach so schnell durch das Wasser wie wenn ich mit dem Paddel ziemlich stümperhaft in See stach. Wir entschlossen uns zu einer Teilumrundung der Halbinsel Mettnau, bei der es immer wieder besondere Vögel, insbesondere auch faszinierende Haubentaucher, und andere Tiere zu bestaunen gibt. Die Sonne brannte vom Himmel, kein einziges Wölkchen war zu sehen. Nur, weil ich unseren Jüngeren auf keinen Fall zu lange beim Lesen und Tischtennisspielen allein lassen wollte, entschieden wir uns zur Rückkehr, ohne noch die sogenannte sehr reizvolle, kleine Liebesinsel umrundet zu haben.

Während sich unser Älterer auf dem SUP entspannte, immer wieder unterbrochen durch meine besorgten Fragen: „Und, wie geht es dir? Fühlst du dich im Unterzucker?“ kamen wir dank meiner fehlenden Paddelkünste nur im Schneckentempo voran, aber immerhin…Wir waren gerade in der Mitte der Seepassage zwischen der Halbinsel Mettnau und unserem Markelfinger Ufer angelangt, als plötzlich ein heftiger Wind aufzog und urplötzlich Wellen aufkommen ließ. Ich hatte vollkommen die Naturgewalten unterschätzt und war höchst beunruhigt, als wir trotz großer Kraftanstrengungen meinerseits genau in die Gegenrichtung gen Insel Reichenau abgedrängt wurden.

Unserem Älteren stand die Sorge ebenfalls im Gesicht geschrieben. Er pfiff vorsorglich schon einmal auf seiner Pfeife, die jeweils in der Schwimmweste der Jungs integriert ist. Der Rettungsruf wurde jedoch sofort vollständig von dem Rauschen des starken Windes verschluckt. Meine Angst wurde immer größer, wollte ich doch sowohl unverzüglich zu unserem Jüngeren zurückkehren, als auch unseren Älteren und mich heil ans Ufer bringen.

Der Himmel hatte sich in Sekundenschnelle in ein tiefes Schwarz verwandelt, von der Ferne war ein Donnergrollen zu vernehmen und die ersten Blitze zuckten vom Himmel. Und wir befanden uns mutterseelenallein inmitten des Bodenseewassers und trieben trotz aller verzweifelten Paddelversuche immer weiter in die falsche Richtung. So entschied ich mich schließlich nach Absprache mit unserem Sohn, vom SUP zu springen und an das rettende Ufer eines mir unbekannten Campingplatzes zu schwimmen, damit unser Älterer ohne mein zusätzliches Gewicht – und natürlich stets unter meiner Aufsicht – möglichst schnell – noch weit vor mir ans Ufer gelangen konnte.

Die Wellen wurden immer stärker und ich schluckte beim schnellen Schwimmen aufgrund der mir entgegenpeitschenden Wogen viel zu viel Wasser, verlor unseren Sohn jedoch nie aus den Augen, der bewundernswert ausdauernd und mutig mit vollem Einsatz gegen die Wellen anpaddelte und sich immer mehr dem Ufer näherte. Ziemlich erschöpft gelangte ich auch ein wenig später ans Ufer. Nun waren wir immerhin schon mal an Land, aber noch einige Hundert Meter von unserem eigentlichem Wiesenplatz entfernt.

Da wir uns ja auch schleunigst um den zu Hause gebliebenen Bruder kümmern mussten, paddelten wir so dicht es ging an dem Schilfgürtel entlang und erreichten eine Viertelstunde später endlich unsere Ausgangsliegewiese. Meine Anfangssorgen hatten sich beim abendlichen Blick auf meine Füße mehr als bestätigt: die Oberseite meiner Füße sowie die Schienbeine waren krebsrot, so dass mir der Sonnenbrand noch Tage später ein bleibendes Andenken an unsere abenteuerliche Fahrt bescheren sollte, der Jüngere empfing uns guter Dinge. Er hatte die Zeit hauptsächlich zum ungestörten Lesen seiner momentanen Lieblingsbuchreihe „Die drei ???“ genutzt und sich erst kurz vor unserer Rückkehr dann doch ein wenig um uns gesorgt.

Nach dem großen Schreck und der Erschöpfung in Kombination mit der Dauermüdigkeit wäre ich am liebsten ins Bett gegangen, aber wir hatten an diesem Abend noch ein großes Programm vor uns. Die Schweiz feiert nämlich stets am 1.August ihre Gründung, welche im Jahr 1291 stattfand, mit opulenten Feuerwerken in vielen Schweizer Städten und Gemeinden.

Einen ganz besonders spektakulären Schauplatz bietet dafür der Rheinfall bei Schaffhausen, immerhin der größte seiner Art in ganz Europa. Auch wenn wir tatsächlich von diesem imposanten Wasserfall ein wenig weniger begeistert waren als von den norwegischen Pendants, bot sich uns nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr ein grandioses Feuerwerk.

Hatten wir die über einstündige Wartezeit darauf noch in strömendem Regen verbringen müssen, hatte der Himmel kurz vor Feuerwerksbeginn ein Einsehen und ließ die Zuschauer die monatelangen Vorbereitungen zahlreicher Pyrotechniker in einer trockenen Umgebung bewundern.

Etwa 20 Minuten erleuchtete der Himmel in stets wechselnden Formationen, mal gold-weiß, mal ganz bunt, mal verschwammen viele Sternfeuerwerke ineinander, mal sprudelte direkt aus dem Rhein ein Reigen aus zahlreichen Lichterfontänen. Das Ende des Feuerwerks wurde schließlich durch einen ganz in Rottönen eingetauchten Wasserfall eingeleitet.

Da der nächste Tag bereits unseren letzten Tag des Bodenseeaufenthalts darstellte, musste dieser selbstverständlich noch einmal ausführlich zum Schwimmen, Springen und SUP-fahren (nur noch ganz dicht am Ufer) genutzt werden. Da es bis zum späten Nachmittag immer wieder regnete und Gewitter gab, konzentrierten sich die Wasserfreuden auf den späten Nachmittag.

Dabei dachte ich mir mal wieder, dass der liebe Gott sich mit mir eigentlich wirklich den falschen Menschen als Mutter zweier Diabetikerkinder ausgesucht hat. Leide ich nicht nur sehr unter allen Arten von Elektrosmog, habe mein Handy fast immer im Flugmodus, natürlich kein tragbares Telefon oder andere strahlende Geräte zu Hause und muss mich nun krankheitsbedingt Tag für Tag auf’s Neue mit zwei Insulinpumpen auseinandersetzen, die Segen und Fluch zugleich sind, auf alle Fälle via Bluetooth alle fünf Minuten eine Kommunikation zwischen der Insulinpumpe und dem jeweiligen Blutzuckersensor ermöglichen.

Und damit noch nicht genug. Es gibt so viele tolle, von Haus aus äußerst ordentliche Menschen und da habe nun ausgerechnet ich die Bürde, zumindest bei all dem Diabetesequipment Ordnung einzuhalten. Es ist mir leider bereits mehr als einmal passiert, dass ich so lange nach dem zweiten Fixierband für den Blutzuckersensor suchen musste, dass es, als ich dieses nach stundenlangem Suchen und Fluchen endlich gefunden hatte, bereits das Gewittern begonnen hatte und die Fixierbänder bis zum nächsten Einsatz abermals unauffindbar waren…

Und wenn es mir dann endlich gelungen ist, fürchte ich bei jedem Sprung ins Wasser – und die Jungs haben diese Disziplin zu ihrer Lieblingsaktivität ernannt – , dass sich trotz des Fixierbands der Blutzuckersensor nach dem zehnten, zwanzigsten oder dreißigsten Sprung verabschiedet….Und leider, leider hatten sich diese meine Sorgen auch heute Nacht mal wieder bestätigt, in der ich nur ausgesprochen kurz zum Schlafen kam.

Gerade als ich gegen 1.00 Uhr nach dem Packen aller Koffer ins Bett gehen wollte, vermeldete die Insulinpumpe des Jüngeren – wahrscheinlich aufgrund der langen abendlichen Schwimm- und Sprungertüchtigung beim Älteren einen Unterzucker. Wie sehr ich es hasse, dem armen schlafendem Kerl mitten in der Nacht erst mühselig die Zahnspange entfernen zu müssen, um ihm anschließend zwei Traubenzucker in den Mund stecken zu können.

Und bei diesem Mal war ich zunächst noch etwas ärgerlich, als er mir plötzlich im Halbschlaf etwas in die Hand drückte, von dem ich im Halbdunklen davon ausging, dass es sich um ein stück nicht gegessenen Traubenzuckers handeln würde, bis ich bemerkte, dass er mir geistesgegenwärtig ein Stück seiner Zahnspange, das bei der nächtlichen Aktion unbemerkt abgegangen war, in die Hand gegeben hatte.

Und dies sollte noch nicht das letzte nächtliche Intermezzo sein. Gegen 3.00 Uhr vermeldete schließlich die Pumpe des Jüngeren, dass man sofort einen neuen Blutzuckersensor stechen müsse. Das viele Springen hatte offenbar den erst drei Tage alten Blutzuckersensor so sehr gelöst, dass er wenige Stunden später ganz vom Oberarm gefallen war.

Sehr erschöpft räumten wir nach einem stärkendem Frühstück unseren in die Jahre gekommenen VW-bus ein, kurz durch einen weiteren Schreckensmoment unterbrochen, da plötzlich das Handy meiner Mutter unauffindbar war -, bevor wir unseren täglichen Automechanikerpflichten in Form der Überprüfung und des Nachfüllens des sich beunruhigend rasch verdünnisierenden Kühlwassers nachkamen.

Da ich diese Tage bei jeder noch so kurzen oder längeren Autofahrt massiv unter den Daueralarmtönen der Öllampe gelitten habe, entschied ich mich für die Heimreise für einen etwas unorthodoxen Weg. Nachdem wir bereits viel Zeit verloren hatten, nach dem Frühstück das munter auslaufende Kühlwasser nachzufüllen sowie den Ölstand und alle weiteren potentiellen Alarmquellen zu prüfen, fuhren wir zuerst noch einige Kilometer von unserem Heimatort weiter weg, um in Konstanz die Autofähre ans gegenüberliegende Bodenseeufer nach Meersburg zu nehmen.

Dort waren wir begeistert, wie schnell und unkompliziert die Fährfahrt von Staad ans andere Bodenseeufer nach Meersburg verlief. Nach einer Viertelstunde Fährfahrt waren wir bereits in der Nähe von Friedrichshafen und hatte uns viel Stau entlang des Bodenseeufers gespart.

Als uns kurz vor der Autobahn plötzlich ein beißender Geruch von verbranntem Gummi in die Nase stieg, sah ich in meiner Panik bereits vor meinem geistigen Auge Flammen aus unserer Motorhaube lodern, was sich glücklicherweise nicht in der Realität ereignete. Nichtsdestotrotz war ich sehr erleichtert, als wir begleitet von den Daueralarmtönen, aber ohne weitere Zwischenfälle wieder die Heimat erreicht hatten…



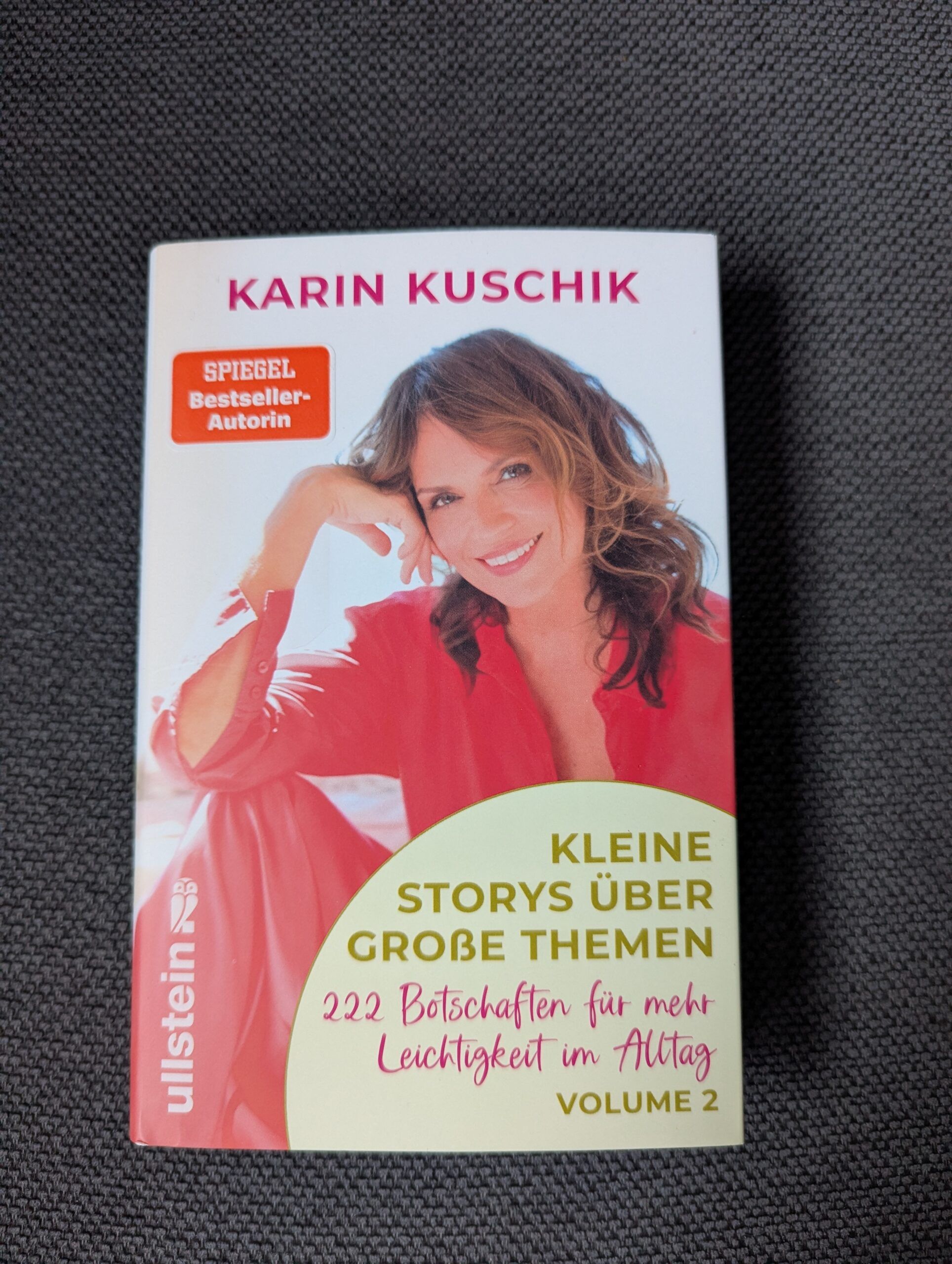
Schreibe einen Kommentar